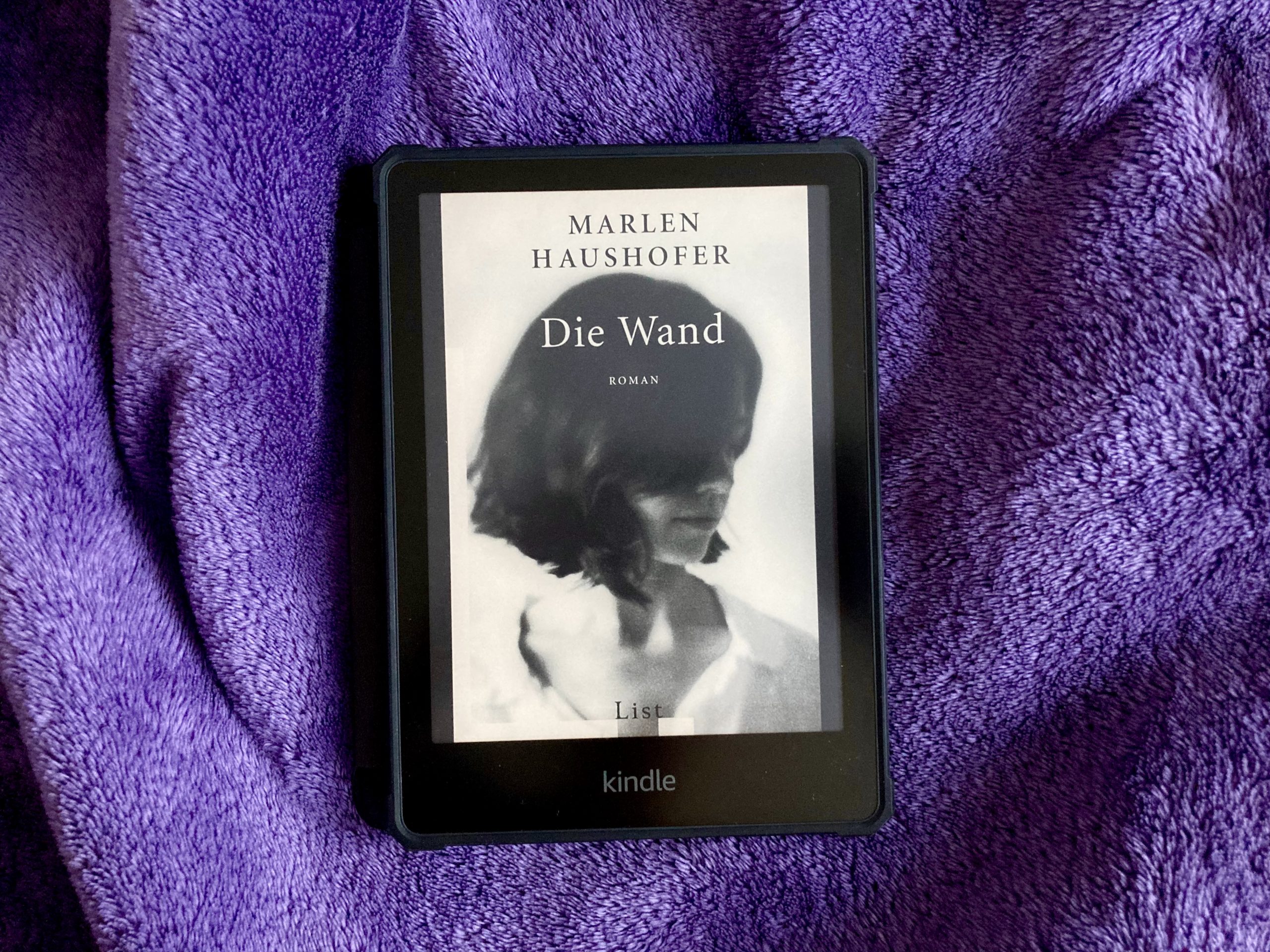Kurzmeinung: Ein Roman, in dem nicht viel passiert, der aber ganz gut von seiner poetischen Sprache und seiner Hauptfigur lebt.
Die namenlose Erzählerin in diesem Roman will eigentlich nur einige nette Tage mit ihrer Cousine und deren Mann in den Bergen verbringen. Als das Paar am Abend noch einmal hinunter ins Dorf geht, ahnt die Protagonistin noch nicht, dass sie die beiden zum letzten Mal gesehen hat. Denn am nächsten Morgen wacht sie allein in der Jagdhütte auf und stellt fest, dass sie durch eine unsichtbare Wand von der Außenwelt abgeschnitten ist.
Diese Idee finde ich sehr spannend, denn Isolation ist immer ein Thema, das mich umtreibt. Umso interessanter ist es, dass die titelgebende Wand im Laufe der Geschichte nur eine untergeordnete Rolle spielt, ja sogar fast in Vergessenheit gerät. Denn nach dem ersten Schreckmoment und einer ersten Untersuchung dieser unsichtbaren neuen Begrenzung ihrer Welt geht die Erzählerin schnell in einen Überlebensmodus über und beschäftigt sich damit, wie sie sich nun mit dem Lebensnotwendigsten versorgen kann. Noch dazu laufen ihr drei Tiere – ein Hund, eine Katze und eine Kuh – zu, denen sie sich nun verpflichtet fühlt. Deshalb unternimmt sie nur eine einzige Erkundungswanderung ins Nachbartal, um herauszufinden, ob auch dort die Wand verläuft. Zwar bestätigt sich dieser Verdacht, aber es ist nicht klar, dass die Wand sie auch von allen anderen Seiten umgibt und sie tatsächlich gefangen ist. Auch die Gedanken der Erzählerin, einen Tunnel unter der Wand durchzugraben, bleiben nur vage Pläne. Schnell wird deutlich, dass sie nicht wirklich unzufrieden mit ihrer Gefangenschaft ist und ihr gar nicht mal so dringend entfliehen will. Vielmehr erschafft sie sich eine eigene kleine Utopie in den Bergen, fernab vom hektischen und oberflächlichen Trubel der Stadt, in der sie bisher gelebt hat.
Die Erzählung handelt hauptsächlich davon: Vom Alltag in der Abgeschiedenheit, der geprägt ist von Verzicht, harter körperlicher Arbeit und der Sorge der Erzählerin um ihre Tiere. Anfangs habe ich das auch richtig gern gelesen; es ist eine schöne Entschleunigung und auf eine ganz eigene Art spannend, die Protagonistin bei der Erkundung ihres neuen Lebens zu begleiten. Kleinigkeiten werden dabei äußerst wichtig – so habe ich mich zum Beispiel sehr mit ihr gefreut, als sie nach langer Zucker-Abstinenz einen Himbeerschlag entdeckt und von den süßen Früchten naschen kann.
Nach einer Weile wird das alles jedoch recht zäh, denn im Grunde geht es die ganze Zeit nur darum, was die Erzählerin Tag für Tag tut: Sie melkt die Kuh, sie schießt Wild, sie mäht Heu, sie kümmert sich um ihr Erdäpfel-Feld. Manchmal geht sie auf eine Erkundungs-Wanderung, manchmal macht ihr das schlechte Wetter ihre Pläne zunichte, manchmal versinkt sie angesichts ihrer Lage in depressiver Stimmung. Aber im Großen und Ganzen passiert nicht viel.
Das einzige, was mich davon abgehalten hat, das Buch abzubrechen, ist die wunderbare poetische Sprache. Die Erzählerin schafft es, ihre simplen Alltagshandlungen und Gedanken auf eine so mitreißende Weise aufzuschreiben, dass sie mich immer wieder in ihren Bann ziehen. Besonders berührt hat mich der Part über die Alm und die Nächte in der endlosen Weite; eine Zeit, die sich für die Erzählerin auf eine ganz bestimmte Weise surreal angefühlt hat und die dieses Gefühl wundervoll auf mich übertragen hat.
Selten denkt die Erzählerin auch über die Menschen und ihre eigene Rolle in der Gesellschaft nach. Besonders faszinierend fand ich einen Absatz, in dem sie beschreibt, wie sie den Bezug zu ihrer eigenen Weiblichkeit verliert. Fernab von allen gesellschaftlichen Erwartungen und Zwängen verliert das Frau-sein für sie zunehmend an Bedeutung, es ist einfach nicht mehr wichtig. An der Stelle habe ich mich sehr gesehen gefühlt.
Manchmal driften ihre Überlegungen über die Menschen und die Städte fast schon in Natur-Kitsch ab, denn sie sieht sich mit ihrem neuen Leben in einer Art Ursprünglichkeit angekommen, die ihr in ihrem früheren Leben verwehrt blieb. Umso interessanter finde ich es hier, dass diese Rückkehr zur Natur als Selbstermächtigung dargestellt wird: Frei von gesellschaftlichen Erwartungen verrichtet sie Arbeiten mit ihren eigenen Händen, gestaltet ihr eigenes Revier und sichert sich selbst und ihren Tieren ganz allein das Überleben. Besonders spannend ist das im Hinblick darauf, wie viel anders dieses „Zurück zur Natur“-Narrativ in der heutigen Popkultur genutzt wird: Mittlerweile bedienen sich hauptsächlich konservative und antifeministische Akteur*innen daran und propagieren damit eine Rückkehr zu einem vermeintlich traditionellen Ideal, zu dem auch veraltete Geschlechterrollen zählen (Stichwort Tradwives).
Ohne an dieser Stelle das Ende spoilern zu wollen: Das, was dort passiert, hat mich kalt getroffen, weil es im Gegensatz zum gleichmäßigen Verlauf der Handlung bis dahin wirklich besonders ist. Eigentlich mag ich es nicht, wenn auf den letzten Seiten noch mal alle Register gezogen werden, das wirkt auf mich immer ein bisschen, als sei den Autor*innen eingefallen, dass irgendwann ja auch noch mal was Spannendes passieren muss. Hier finde ich es aber sehr passend; es hat einen symbolischen Charakter und zeigt in der Reaktion der Protagonistin, wie sehr sie sich angesichts ihres neuen Lebens verändert hat.
Das Einzige, was mich an diesem Buch wirklich gestört hat, ist das unsägliche Nachwort von Klaus Antes – ein Autor, der so irrelevant ist, dass er noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat. Trotzdem meint er, sich über das (Gefühls-)Leben von Marlen Haushofer auslassen zu müssen: Dass sie bescheiden und harmoniebedürftig gewesen sei und sich ihr Leben lang nach Zuneigung gesehnt habe. Das Ganze in einem so gönnerhaften, paternalistischen Ton, dass sich in mir alles kringelt und ich mir die (rhetorische) Frage stelle, ob jemand so ein Gesülz auch über einen männlichen Autor schreiben würde. Und das ist kein einmaliger Ausrutscher: In einem Buchclub habe ich festgestellt, dass dieses Nachwort sowohl in einer älteren Print-Ausgabe als auch in der neueren E-Book-Ausgabe enthalten ist. Als Herausgeber*in bzw. Verlag wäre mir das ja peinlich.